Happyland ist das Land, in dem es sich weiße Menschen ein wenig gemütlich gemacht haben. Man profitiert selbst und fühlt sich noch gut dabei. Alles gar nicht mal unbedingt bewusst, um anderen zu schaden, sondern vielleicht aus einer Mischung aus Gewohnheit, Trägheit, Blindheit für das Offensichtliche und noch manch anderem. Besonders betroffen und gefährdet sind hier diejenigen, die sich selbst für weltoffen/liberal/links und Rassismus für etwas halten, das ganz weit weg von Ihnen geschieht. Selbstverständlich aber nicht im eigenen Happyland – da hatten wir ja schon einen Blick drauf geworfen.
Ein entscheidender Faktor, dass dieses Leben im Happyland so gut funktioniert, ist seine Grenzschutz-Polizei. Sie steht im Bild für das, was in der Rassismus-Debatte auch als „white fragility“ (weiße Zerbrechlichkeit) bezeichnet wird. Gemeint ist damit eine mehr oder weniger starke Abwehrhaltung, die beinahe automatisch einsetzt, wenn das Thema Rassismus uns zu nahe rückt.
Schon die Rede von „den Weißen“ ist für die meisten von uns ausgesprochen ungewohnt, weil wir schlichtweg nicht damit vertraut sind, als Teil einer solchen Gruppe wahrgenommen zu werden. Die Rede von „Schwarzen“/“Farbigen“/“BiPoC“ dagegen ist für uns gewohnter – das geht uns leicht über die Lippen. Auf uns selbst bezogen spüren wir dann aber in Regel auch gleich ein Unwohlsein darüber, dass es ja wohl nicht sein kann, dass ich jetzt für eine riesige Gruppe von weißen Menschen repräsentativ sein soll! Übrigens eine Erfahrung, die BiPoC regelmäßig machen, wenn sie wie selbstverständlich für alle Menschen ihrer Hautfarbe sprechen sollen.
Und wenn dann unterschwellig angedeutet oder sogar konkret ausgesprochen der Begriff „Rassismus“ im Raum steht – und jetzt eben im Hinblick auf unser eigenes Denken und Verhalten, auf unsere eigene Person oder Institution – dann kann man schon davon ausgehen, dass dies quasi reflexartig abgewehrt werden MUSS. Denn mit Rassismus haben WIR ja nichts zu tun! Dagegen haben wir uns in der Vergangenheit kategorisch abgegrenzt. Rassisten tragen Springerstiefel oder sitzen für die AfD im Bundestag. Das sind nicht wir, sondern die anderen.
Problem ist: Mit der (nach dem zweiten Weltkrieg absolut verständlichen und vielleicht auch nötigen) starken Abgrenzung vom Rassismus geht auch zugleich seine Tabuisierung einher. Rassismus verschwindet leider nicht, indem wir ihn ignorieren und nicht benennen. Und durch die Tabuisierung wird er zugleich ungleich schwerer zu bekämpfen.
Für mich ist deshalb eine entscheidende Erkenntnis, auf diesem für mich ja auch noch neuen Weg zu sagen: „Ja, auch ich bin rassistisch sozialisiert. Ja, auch in mir wirken rassistische Mechanismen. Ja, auch ich denke und handle immer wieder rassistisch.“ Dabei geht es nicht darum, dass ich mich selbst verurteile und klein mache. Sondern es geht darum, dass ich mir selbst über meine Sozialisation bewusst werde, dass ich konstruktiv mit dem Erkannten umgehe und dass ich in erwachsener Weise Verantwortung für mein Denken und Handeln in der Gegenwart und Zukunft übernehme. Dabei wird mir auch nicht alles gleich gelingen, denn jahrzehntelange Prägung schüttelt man nicht einfach so ab. Was zählt, ist, dass ich mich auf den Weg mache und mit und von anderen lerne.
Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe über Rassismus. Hier findest du die anderen Beiträge:
Teil 1: Zuhören als Grundvoraussetzung
Teil 2: Doch nicht in Deutschland!
Teil 3: Geschichte ist nicht obsolet
Teil 4: White Privilege
Teil 5: Happyland

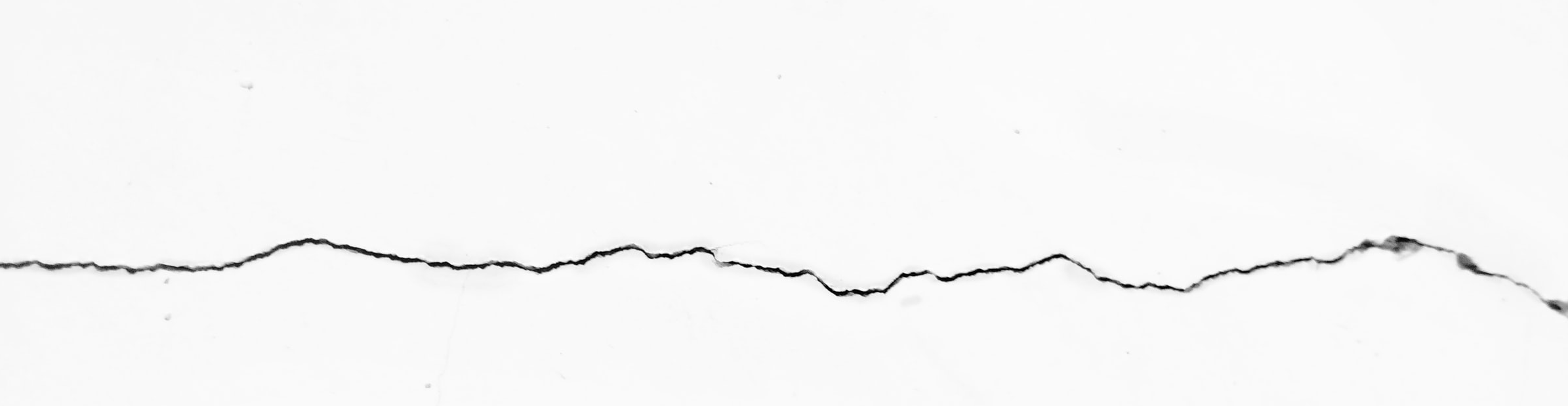
Helgard
Einfach nur: Danke! Danke für diesen wertvollen wie reflektierten Beitrag und Chapeau für die ehrliche Auseinandersetzung mit all den Facetten, die diese schwere Thematik mit sich bringt. Ich wünschte, ich könnte Menschen in meinem Umfeld dafür sensibilisieren, sich ebenfalls tiefer mit ihren Prägungen beschäftigen, statt sich -sobald die Thematik auf den Tisch kommt- permanent reflexhaft in die Operrolle zu begeben. „Rassismus ist natürlich in Ordnung- aber auch nicht gegen Weiße“ , „Ich wurde auch schonmal im Supermarkt darauf angesprochen, dass ich zu dick bin- na und?“ (Ähm- Wie bitte?) Nur zwei von vielen Aussagen, die mir bisher wenig Hoffnung machten, dass es auch nur im Ansatz eine Bereitschaft geben könnte, sich tiefer in die „unangehme Materie“ zu begeben, um sich ernsthaft mit einer Thematik auseinander zu setzen, die im Grunde eben nicht die eigene ist.
Das ich dennoch hoffen darf, zeigt der Autor auf eindrucksvolle Weise in seinem Beitrag. Nochmal- vielen Dank dafür!
Simon de Vries
Vielen Dank für die nette Rückmeldung! Ich erlebe es ganz ähnlich – auch an mir selbst. Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist anstrengend. Aber halt nötig.